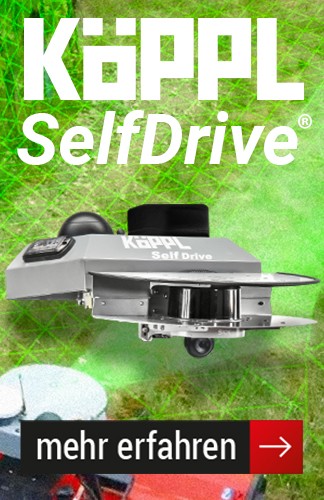Digitalisierung und moderne Technologien sind längst zu unverzichtbaren Bestandteilen der Landwirtschaft geworden. Sie steigern die Effizienz, optimieren den Ressourceneinsatz und ermöglichen eine zunehmende Automatisierung. „Die prämierten Arbeiten sind beeindruckende Beispiele dafür, wie Innovation und Landwirtschaft Hand in Hand gehen können“, betonte Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung. „Mit dem Förderpreis wollen wir junge Talente ermutigen, ihre innovativen Ideen weiterzuverfolgen und auch für die (Versicherungs-) Wirtschaft nutzbar zu machen.“
Niederösterreich als Bildungs- und Agrarstandort
„Niederösterreich ist nicht nur das Agrarland Nummer eins, sondern auch ein bedeutender Wissenschafts- und Bildungsstandort. Daher freut es mich umso mehr, dass wir hier Landwirtschaft und Wissenschaft verbinden, an neuen Lösungen forschen und auch in die bäuerliche Praxis umsetzen können“, unterstrich LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. „Förderpreise wie jener der Österreichischen Hagelversicherung tragen dazu bei, dass Niederösterreich auch künftig gleichzeitig zukunftsstarkes Agrarland und innovativer Wissenschaftsstandort bleibt.“
Die Preisträger und ihre Projekte
Fabian Butzenlechner untersuchte in seiner Arbeit die Auswirkungen von Standortunterschieden innerhalb von Feldern auf Biomasseentwicklung und Ertrag. Durch die Nutzung langjähriger Fernerkundungsdaten aus dem Sentinel-2-Satellitenprogramm konnten teilflächenspezifische Aussaatkarten für Körnermais erstellt werden. Die Versuche – durchgeführt in verschiedenen Klimaregionen Österreichs von 2020 bis 2022 – zeigten durchwegs Ertragssteigerungen durch die variable Aussaat. Besonders stark korrelierte der Ertrag mit den Niederschlagsmengen während der kritischen Blütezeit im Sommer.
Jakob Silber untersuchte das Potenzial photoelektrischer Körnerzählsysteme für pneumatische Sämaschinen. Dabei analysierte er die Genauigkeit verschiedener Sensortechnologien bei der Erfassung einzelner Saatkörner im Luftstrom. Seine Forschung zeigte, dass eine präzisere Körnerzählung die Dosierung optimieren, Fehlstellen reduzieren und die Saatgutnutzung effizienter gestalten kann. Insbesondere konnte er nachweisen, dass die Wahl des Sensortyps sowie dessen Positionierung im Luftstrom erheblichen Einfluss auf die Messgenauigkeit haben.