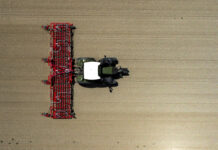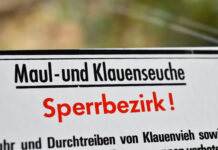In Österreich sind die Treibhausgas-Emissionen in den vergangenen 25 Jahren insgesamt um 13,6 Prozent (%) zurückgegangen. Das zeigen aktuelle Daten des Umweltbundesamtes. Während die Emissionen in einigen Sparten wie zum Beispiel dem (Flug)verkehr gestiegen sind (+44,2 %), konnten sie in der heimischen Landwirtschaft um 14,5 % reduziert werden. Hatten die landwirtschaftlichen THG-Emissionen 1990 noch einen Anteil von zehn Prozent an den gesamten österreichischen Treibhausgasemissionen, so liegt der Anteil aktuell nur noch bei 8,5 %. „Wir bewegen uns also beim Abbau von Treibhausgasen innerhalb des in internationalen Abkommen und gesetzlichen Regelungen festgelegten Reduktionspfads“, betont Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger.
Hauptgrund für die sinkende Tendenz bei den THG-Emissionen in der Landwirtschaft ist vor allem die Reduktion der Tierbestände vor allem im Rinder- und Schweinebereich. Aber auch die Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung auf den Betrieben sowie die Forcierung von klimaschonenden Bewirtschaftungspraktiken haben zur Senkung beigetragen. „Wir arbei-ten hier in der Bildungs- und Beratungsarbeit mit unseren Bäuerinnen und Bauern hart an der Umsetzung der dazu erforderlichen Maßnahmen. Trotzdem müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass sich natürliche Produktionsprozesse in Tierhaltung und Pflanzenbau, trotz Wissenschaft und Forschung, am Ende nie klimaneutral im Sinne der aktuellen Klimabilanzierungsregelungen gestalten lassen“, erläutert Waldenberger.
“Es braucht eine Neubewertung der Klimawirkungen der landwirtschaftlichen Produktion.” Franz Waldenberger
Öpul ist ein wesentlicher Hebel zur Senkung
Ein wesentlicher Hebel zur Senkung der THG-Emissionen im Pflanzenbau sei die hohe Teilnahmerate der Bäuerinnen und Bauern am Agrarumweltprogramm Öpul, inklusive der besonders klimawirksamen Maßnahmen und Programme zum Boden- und Gewässerschutz. In Oberösterreich liegt die Öpul-Teilnahmerate der Betriebe mit 85 % mittlerweile über dem Bundesschnitt von 83 %. „Das ist insofern bemerkenswert, als in unserem Bundesland die höchste Tierhaltungsintensität und auch in der Pflanzenproduktion aufgrund günstiger natürlicher Produktionsbedingungen die höchsten Naturalerträge zu verzeichnen sind, die tendenziell die Teilnahme an Maßnahmen des Agrarumweltprogrammes wirtschaftlich weniger attraktiv machen“, betont der oberösterreichische Landwirtschaftskammer-Präsident.
 Quelle: Agrarfoto.com
Quelle: Agrarfoto.comHumusfördernde Bewirtschaftung
Ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Klimaeffizienz ist der Aufbau organischer Bodensubstanz, also der Erhalt gesunder Böden. „Es ist eine der wichtigsten Aufgaben des Ackerbaus in Zeiten des Klimawandels, humusfördernde Bewirtschaftungspraktiken zu forcieren, um die Humusgehalte auch unter den prognostizierten künftigen Klimabedingungen zu erhalten“, ist Waldenberger überzeugt. Positiv auf die Humusgehalte der Böden wirke sich beispielsweise die Reduzierung der intensiven Bodenbearbeitung aus. „Die Landwirtschaftskammer und die Boden.Wasser.Schutz.Beratung schulen die Bäuerinnen und Bauern gezielt in diese Richtung, um die Bodenstrukturen zu verbessern und die Wasserspeicherkapazität der Böden zu erhöhen“, so Waldenberger.
Weitere Maßnahmen zum Erhalt gesunder Böden und zur Anpassung des Ackerbaus an den Klimawandel sind die Reduktion von Bodenverdichtungen, der Anbau von qualitativ hochwertigen Begrünungen, das Belassen der Ernterückstände am Feld, die vermehrte Anlage von Hecken oder Biodiversitätsflächen. „Durch verbesserte Steuerung des Betriebsmitteleinsatzes mittels Precision Farming können Betriebsmittel wie Pflanzenschutzmittel, Dünger oder Saatgut genauer auf den Standort und die Bedürfnisse der Kultur abgestimmt werden“, erläutert der Landwirtschaftskammer-Präsident
Tierhaltung im Zentrum der Kreislaufwirtschaft
Im Zentrum einer funktionierenden, kreislauforientierten Landwirtschaft steht die Tierhaltung. Denn nur damit können Grünland- und Ackerfutterflächen, die fast die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Oberösterreich darstellen, überhaupt für die Agrar- und Lebensmittelproduktion genutzt werden.
Natürliche Produktionsprozesse wie zum Beispiel im Wiederkäuermagen von Rindern werden sich aber hinsichtlich der Klimawirkungen nur sehr begrenzt optimieren lassen. „Es gibt hier mittlerweile eine ganze Reihe renommierter Klimawissenschafter, die eine Änderung der bestehenden Klimabilanzierungsregelungen im Bereich Methan fordern. Der biogene Methanausstoß bewegt sich seit Jahrhunderten in einem natürlichen Kreislauf und ist gesamthaft betrachtet nicht wirklich ein Mitverursacher der aktuellen Klimakrise. Diese resultiert vor allem aus der überbordenden Nutzung fossiler Energieträger, die massive Mengen an zusätzlichem CO2 in die Erdatmosphäre einbringen. Hier braucht es tatsächlich eine fundierte Neubewertung der Klimawirkungen der landwirtschaftlichen Produktion sowie einen umfassenden Blick auf die gesamten Ökosystemleistungen einer bäuerlichen strukturierten landwirtschaftlichen Nutztierhaltung“, fordert Waldenberger.
Ständig aufkommende Forderungen und Diskussionen zu einem Abbau der Tierhaltung würden dem Agrarstandort Oberösterreich massiv schaden und insbesondere der Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln gefährden. Waldenberger ist überzeugt: „Nur unsere bäuerlich strukturierte Familienlandwirtschaft mit ihrer ausschließlich bodengebundenen Produktion kann eine Tierhaltung im Einklang mit gesellschaftlichen Forderungen nach hohen Umwelt-, Klima- und Tierschutzstandards sicherstellen.“
- Bildquellen -
- Regenwuermer Bioackerbau: Agrarfoto.com