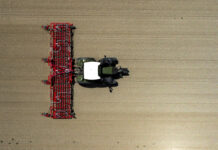Mit dem Anbau von Einkorn, Emmer, der Dinkelsorte Ostro, Khorosan-Weizen (Kamut), Waldstaudenroggen oder Rotweizen hat Heinrich Unger aus Wallern über beinahe vier Jahrzehnte hinweg alte Getreidesorten kultiviert. Seine Frau Elisabeth hat daraus selbst gebackene Vollkornbrote und Backwaren produziert und diese neben verschiedenen Gemüsesorten 23 Jahre lang im eigenen Hofladen Kunden angeboten. Nun wechselt der Landwirt demnächst in den Ruhestand. Auch die Brotbäuerin hört auf.
Viele gute Gründe für Urgetreide
Vom Anbau alter, robuster Kulturpflanzenarten „auch als Antwort auf die Herausforderungen unserer Umwelt“ sind beide weiterhin überzeugt. Speziell für die Produktion von Urgetreide gebe es „viele gute Gründe, beginnend von der Ursprünglichkeit des Saatguts über die gute Verträglichkeit des daraus gemahlenen Vollkornmehls (dank höherer Gehalte an Aminosäuren, Protein und Vitamin) bis hin zur Resistenz gegen Krankheiten oder Schädlinge. Statt diese etwa chemisch zu beizen, nutzen die alten Sorten Pytinsäure als natürlichen Schutz etwa gegen Pilze.
Urgetreide ist das neue Superfood
Favorit der Brotbäuerin ist das Einkorn, „weil ungezähmt zart und intensiv nussig zugleich“. Wenn auch wenig ertragreich, sei Urgetreide „das neue Superfood“, sagt Elisabeth, die gemeinsam mit Melanie Zechmeister auch das 300 Seiten starke Buch „Rezepte für eine gute Zeit“ (Verlag Löwenzahn) geschrieben hat.
Von ihrem Urgetreide haben die Ungers noch rund 2.000 Kilogramm je Art und Sorte auf Lager, das sie gerne an interessierte Landwirte günstig (ab 1,50 Euro je kg) abgeben würden.
Interessenten melden sich am besten per Tel. 0650/7151061 oder per E-Mail an
lisbeth.natur@gmail.com
- Bildquellen -
- Emmer Ähre: WF Seydlbast- stock.adobe.com