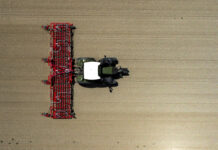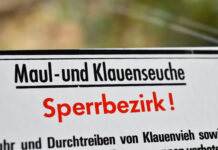BauernZeitung: Vorsitzender der Hochschülerschaft an der Boku, Mitbegründer der Bäuerlichen Bildungsgemeinschaft Südkärnten und Obmann der örtlichen Agrargemeinschaft. Wenn man den Lebenslauf von Hans Mikl anschaut, zieht sich der Einsatz für den Bauernstand als roter Faden durch. War ihr Weg zum Kammeramtsdirektor vorgezeichnet?
MIKL: Nein, dass ich die Stelle bekommen habe, war Zufall. Der Bauernstand hat mich aber eigentlich immer schon interessiert. Ich bin schon früh von meinen Eltern als Hofübernehmer gehandelt worden. Der damalige Direktor am Stiegerhof riet ihnen dann, mich in eine Landwirtschaftliche Mittelschule zu schicken. Nach dem Abschluss in Ursprung- Elixhausen hatte ich dann noch die Möglichkeit, ein Boku-Studium anzuhängen. Dort hat es mich dann mit einer Runde motivierter Herren in die Studienrichtungsvertretung und den ÖH-Vorsitz verschlagen.
Also haben Sie schon in Wien Vertretungsluft geschnuppert?
Ja, es hat mich einfach interessiert. Mein Ziel, daheim den Hof zu übernehmen, stand dennoch fest. So bin ich nach dem Studium wieder heimgekommen und habe hier erstmal einiges umgekrempelt. Mein Vater hat einen gemischten Betrieb mit Schwerpunkt Ferkelproduktion betrieben. Da die Stallungen aber zu erneuern gewesen wären, habe ich den Betrieb auf pflanzliche Produktion mit Fokus auf Direktvermarktung ausgerichtet. Wir haben mit Erdbeeranbau begonnen und die Speiseölproduktion professionalisiert. Später kam noch ein Kompostierungsprojekt dazu.
Die Arbeit für die Bauern ließ Sie aber dennoch nicht los. Oder?
Nein. Mit meinen Wegbegleitern Stefan Domej und Hans Madritsch haben wir damals festgestellt, dass es keine agrarische Weiterbildung in slowenischer Sprache gab. Das war uns als Teil der Volksgruppe natürlich ein Anliegen. So haben wir die Bäuerliche Bildungsgemeinschaft Südkärnten (KIS) gegründet. Von 1997 bis 2000 war ich dann in der LK Kärnten für Interreg-Projekte mit Slowenien zuständig. Später folgten Projekte in der Slowakei und in Kroatien. Mit damals drei kleinen Kindern, Betrieb und Vollzeitjob war die Belastung aber groß, weshalb ich mich vorerst wieder auf den Hof und die Familie konzentrierte.
2010 war dann, nach 26 Jahren unter Kammerdirektor Ernest Gröblacher, dessen Stelle vakant.
Niemand hat damals damit gerechnet, dass der Job ausgeschrieben wird. Wir waren gerade mit dem Umbau der alten Stallungen für die Direktvermarktung fertig. Der Posten hat mich gereizt und so habe ich mich beworben. Dass ich zum Zug gekommen bin, war nicht selbstverständlich. Im Herzen war ich immer ein Christlich-Sozialer, jedoch aus der slowenischen Volksgruppe. Da gab es dann viel politischen Gegenwind, der sich später aber gelegt hat.
Wie ist es Ihnen beim Sprung in die Fußstapfen Ihres Vorgängers ergangen?
Der Einstieg war schwer. In viele Themen musste ich mich ordentlich hineinknien und die Sitzungen in Wien waren natürlich nach der Zeit am Hof auch neu. Bei seinen zahlreichen Publikationen zum EU-Beitritt konnte ich Gröblacher natürlich nicht das Wasser reichen. Ich bin ihm aber sehr dankbar für die geleistete Aufklärungsarbeit unter der Bauernschaft. Viel Zeit zur Eingewöhnung im Kammeramt blieb mir aber nicht, da schon bald die ersten politischen Themen aufschlugen.
Die da wären?
Zunächst mal die Futterflächen- Feststellung auf den Almen. Da waren wir plötzlich mit großen Rückzahlungsforderungen bei unzähligen Auftreibern konfrontiert. Das Problem war, wir als Kammer waren ja über die Luftbilderüberprüfung für die AMA mittendrin.
“Das Futterflächen-Thema hatte auch politisch Explosionspotenzial.”
Mittlerweile ist es ja in dieser Causa deutlich ruhiger geworden. Wie ist das gelungen?
Da war viel Überzeugungsarbeit in den Gremien nötig, auch in Wien. Da haben uns auch wir Kärntner umfassend eingebracht. Schlussendlich ist das System erst unter Andrä Rupprechter als Minister geändert worden. In einem ersten Schritt wurden von der AMA die Auftreiber freigespielt und hafteten nicht mehr für die manches Mal ungenauen Angaben der Obleute der Almgemeinschaften. Zeitgleich haben wir im Haus auf intensive Schulungen gesetzt. Das Ganze hatte auch politisch Explosionspotenzial. Wir waren alle sehr gefordert. Es war für die Almbauern eben nicht einfach zu verstehen, dass das nur bedingt auf nationaler Ebene gelöst werden kann, weil es EU-konform geregelt sein muss.
Die nächste Herausforderung ließ aber wohl nicht lange auf sich warten, oder?
Die kam im Herbst 2014 mit dem HCB-Skandal im Görtschitztal. Leider haben sich unsere Befürchtungen rasch bestätigt, dass auch die Landwirtschaft massiv betroffen ist, durch die unsachgemäße Verbrennung fand sich das Hexachlorbenzol plötzlich überall. Die Bauern waren natürlich als Erstes dran. Anfangs wurde die Milch nach Wien-Simmering zur Verbrennung geführt. Rückblickend muss man aber sagen, die Zusammenarbeit zwischen Kammer, Land, Molkereien und Verbänden hat gut funktioniert, bei den Bauern gab es keinen Milchstau.Wir haben damals in der LK viele Überstunden machen müssen, auf den Kosten dafür sind wir leider sitzen geblieben. Zwar haben wir Rechnungen an den Verursacher gestellt, bezahlt wurde aber nie. Das einzig Gute: Nachdem alle Heustadel geräumt waren, kam es auch zu keiner Neukontamination mehr, die nächste Ernte war wieder „sauber“.
Stichwort Kammerfinanzierung. Die Kammerumlage war ja über Jahrzehnte nicht angepasst worden. Wie gingen Sie damit um?
Das Wichtigste, das einen Kammerdirektor der LK kennzeichnen muss, ist Verständnis für die Menschen und Sparsamkeit. Die Kammerumlage basiert ja bekanntlich auf dem Einheitswert. Da dieser über Jahre gleichblieb, war auch die Umlage dementsprechend konstant, über 26 Jahre lang. Und das geht gar nicht d‘accord mit den Entwicklungen im Personalbereich, konkret mit den Lohnkosten und der Inflation. Da blieb uns im ersten Schritt nur die Möglichkeit, Personal abzubauen. Ich habe aber niemanden gekündigt, sondern mehr als 20 Positionen nicht mehr nachbesetzt. Stolz bin ich darauf nicht, aber es war schlicht eine wirtschaftliche Notwendigkeit.
“Das Wichtigste, das einen Kammerdirektor kennzeichnen muss, ist Verständnis für die Menschen und Sparsamkeit.”
Die Beratungs- und Vertretungsarbeit wurde aber wohl nicht weniger?
Nein, ganz im Gegenteil. Unsere Anforderungen sind gestiegen im Laufe der Zeit. Obwohl die Anzahl an Betrieben abnimmt, geben die Bauern heute ein viel differenzierteres Bild ab. Vom Green-Care-Betrieb über Direktvermarkter bis zu hochspezialisierten Betrieben, alle wollen beraten und vertreten werden. Eigentlich hätte die LK mehr Personal gebraucht, wir mussten es aber mit Umverteilungen und weniger Leuten schaffen.
Bringt die Novelle des Kammergesetzes nun die ersehnte Erleichterung?
Erst kürzlich ist es uns mit der Novelle des Kammergesetzes gelungen, die Kammerumlage zu erhöhen. Der Grundbetrag steigt von 21,80 Euro auf 49 Euro. Denn viele Betriebe zahlen nur den Grundbetrag oder drei, vier Euro mehr. Das war nach so vielen Jahren jedenfalls ein wichtiger Schritt, um die Interessensvertretung für die Zukunft abzusichern.
“Die Erhöhung war ein wichtiger Schritt , um die Interessensvertretung für die Zukunft abzusichern.”
Stichwort Zukunft: Hier wurde ja 2020 auch mit dem Präsidenten Mößler und danach mit Huber der Visionsprozess „Zukunft Land- und Forstwirtschaft 2030“ angestoßen. Die Bauern waren eingeladen, ihre LK von morgen mitzugestalten. Wie läuft die Umsetzung?
Solche breitenwirksamen Projekte sind wichtig, um zu klären, wohin man sich entwickelt und vor allem wo verlangen die Damen und Herren Mitglieder, dass wir vielleicht neue Zeichen setzen und uns neu orientieren. Da kamen viele konstruktive Punkte, unter anderem wurde danach etwa die Öffentlichkeitsarbeit ausgebaut. Und der Prozess der Anpassung hört eigentlich nie auf. Warum soll er auch? Auch bei den Bauern draußen ist ein ständiger Anpassungsprozess notwendig.
Um sich an Veränderungen anzupassen, ist auch Bildung essenziell. Die Sanierung des Bildungshauses Schloss Krastowitz stand unter Ihrer Führung auch an. Ein Herzensprojekt?
Grundsätzlich ja, denn Bildung ist der Schlüssel für erfolgreiche Betriebe. Wir mussten aber auch investieren, um barrierefrei zu werden. Wir haben aber von 2013 bis jetzt gebraucht, um die Finanzierung sicherzustellen. Man muss wissen, mit so einer Einrichtung verdient man nichts, das muss man ehrlich sagen. Ich musste mich also bemühen, dass wir uns als LK nicht übernehmen. Hier lasse ich auch das Land als eigentlich für Weiterbildung gesetzlich Zuständigen nicht aus der Verantwortung. Die finale Zusage für Geldmittel haben wir aber erst unter Agrarlandesrat Martin Gruber bekommen.
Welche Pläne haben Sie für die Pension?
Für mich ist wichtig, auch jetzt Ziele und Projekte vor Augen zu haben. Als erstes Projekt werde ich demnächst mit einer Genossenschaft den Bau eines Kleinwasserkraftwerkes mit 150 kW Leistung beginnen. Und natürlich werde ich meinem Sohn, der schon die Bewirtschaftung übernommen hat, als erster Knecht zur Hand gehen. Der Ölproduktion will ich mich noch intensiver widmen und auch bei der Kompostierung will ich noch etwas optimieren. Interessieren würde mich auch die Insektenproduktion für Fischfutter und Aquakultur an sich. Einen Pensionsschock fürchte ich nicht. Landwirt sein ist zwar wirtschaftlich hart, aber für mich gibt es keinen schöneren Beruf.
Zur Person: DI Hans Mikl, verheiratet, fünf Kinder; Bauernhof vulgo Gams, Hart/Ločilo (Arnoldstein); Schwerpunkte: Speiseöle, Kompostierung, Forstwirtschaft, 24/7-Hofladen
- Bildquellen -
- Hans Mikl: BZ/Wieltsch