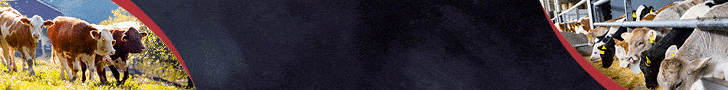Hirsen sind Kulturpflanzen, die ihren Ursprung im Mittelmeerraum und in den südlichen Ländern Asiens haben. Vor allem in Afrika und Asien ist Hirse noch heute eine der wichtigsten Getreidepflanzen. Aufgrund ihrer Abstammung kommt die Kultur sehr gut mit trockenen und heißen Bedingungen zurecht und liefert auch in Trockenjahren stabile Erträge. Aufgrund der zukunftsträchtigen Rolle in der Welternährung wurde bei der UN-Generalversammlung das Jahr 2023 zum „internationalen Jahr der Hirse“ erklärt. Für das Erntejahr 2022/23 wurde ein weltweites Erntevolumen von circa 62,7 Millionen Tonnen prognostiziert.
Eine wärmeliebende Pflanze, ähnlich wie der Mais
Vor allem die Gattung der Sorghumhirse bietet eine gute pflanzenbauliche Alternative. Sie besitzt größere Körner und zeigt viele Gemeinsamkeiten mit dem Mais auf. Die wärmeliebende Pflanze benötigt deutlich weniger Wasser als Mais und ist bei Trockenperioden wesentlich resistenter. Ab einer Bodentemperatur von mindestens elf Grad kann die Aussaat entweder mit einer Einzelkorn- oder einer Drillsämaschine durchgeführt werden. Die optimale Saattiefe liegt bei zwei bis drei Zentimeter. Gegenüber Frösten und kühlen Frühjahrstemperaturen ist das Getreide aber empfindlich. Für einen Hektar braucht man circa 10 bis 15 Kilo (kg) Saatgut. Anzustreben ist dabei eine Bestandesdichte von 20 bis 40 Pflanzen pro Quadratmeter. Die Unkrautbekämpfung sollte aufgrund der langsamen Jugendentwicklung bereits im Vorauflauf erfolgen. Generell gibt es bei Hirsen kaum einen Krankheits- und Schädlingsdruck. Die Boden.Wasser.Schutz.Beratung der Landwirtschaftskammer OÖ führt seit einigen Jahren den Landessortenversuch mit Sorghumhirse durch. Dabei werden verschiedene Sorten auf unterschiedlichen Standorten in Oberösterreich getestet und mittels Kerndrusch auf den Ertrag ausgewertet.
In der Fruchtfolge ist Hirse eine gute Alternative
Bei einem mittleren Ertragsniveau von 6,5 bis 8 Tonnen kann mit einem Düngebedarf von etwa 150 kg Stickstoff, 85 kg Phosphor und 210 kg Kalium gerechnet werden. Das Getreide gilt als guter Gülleverwerter, stellt jedoch aufgrund der hohen Nährstoff- und Wassernutzungseffizienz eine schlechte Vorfrucht dar. Bei der UBB–Maßnahme wird sie nicht dem Getreide-Maisanteil untergeordnet. Vor allem zur Auflockerung der Fruchtfolge bietet Hirse eine mögliche Lösung gegen den Maiswurzelbohrer und kann in der Schweinefütterung eingesetzt werden. Die Felder können mit der herkömmlichen Landtechnik bewirtschaftet werden. Im Rahmen des vierjährigen Forschungsprojektes „Klimatech“ wurde der Fokus auch weiter auf Alternativsorten gelegt. Das Projekt bildet die gesamte Wertschöpfungskette ab. Angefangen von der Landwirtschaft über Trocknung, Schälung, Vermahlung bis hin zum verarbeitenden Betrieb (beispielsweise Bäcker) sind alle wesentlichen Akteure am Projekt beteiligt. Zudem begleitet die Wissenschaft die Verarbeitungsschritte mit umfassenden Analysen.
Viele Getreidesorten eignen sich gut zum Brotbacken
Durch die Klimaveränderungen in Österreich verändert sich die Qualität des wichtigsten Brotgetreides, dem Weizen. Durch die steigenden Temperaturen erhöht sich der Glutengehalt im Weizen. Zwar ist dies ein wichtiges Qualitätsmerkmal, jedoch kann ein zu hoher Glutengehalt bei feinen Backwaren, wie beispielsweise einem Brioche, die Qualität beeinträchtigen. Daher wird an gultenfreien Getreidesorten wie Hirse, Amarant und Buchweizen geforscht.
 Quelle: HTLLMT Wels
Quelle: HTLLMT WelsEin Mix aus Hirse und Weizen eignet sich gut für Semmeln
Im Rahmen von mehreren Diplomarbeiten befassten sich die Schüler der HTL für Lebensmitteltechnologie in Wels mit Sorghummehl. Dabei haben sie sich genau angesehen, wie sich die Zugabe von Sorghummehl bei der Herstellung von Backwaren auf die Verarbeitung der Teige, das Backverhalten und die Qualität der erzeugten Produkte auswirkt. Durch die Beimengung von glutenfreien Mehlen soll ein Ausgleich erzielt werden, ohne dabei die Backqualität negativ zu beeinflussen. Erzeugt wurden Semmeln, Plundergebäck und Brioche. Die Schüler untersuchten die Backwaren weiters auch auf die Verarbeitbarkeit, Formgebung sowie die Teigstabilität. Anhand eines sensorischen Benotungssystems wurden Unterschiede in Bezug auf Aussehen, Textur, Haptik und Aroma festgestellt und bewertet. Bei der Teigzubereitung wurde in Fünf- Prozent-Schritten Weizenmehl mit Sorghummehl ausgetauscht. Ziel der Arbeit war es herauszufinden, wie viel Sorghummehl beigemengt werden kann, ohne dass für den Endkunden ein Qualitätsverlust in Bezug auf Aussehen und Geschmack entsteht.
Bis 15 Prozent kann Weizen ausgetauscht werden
Anhand der Ergebnisse kann festgehalten werden, dass eine Zumischrate bis 15 Prozent von Sorghummehl zum Weizenmehl möglich ist. Ab 20 Prozent machte sich ein bitterer Beigeschmack und ein raues Mundgefühl bemerkbar. Auch der visuelle Eindruck leidete und die Backstücke wurden gräulicher und dunkler. Die Laboruntersuchungen bestätigten den
Qualitätsabfall ab einer Zugabe von 15 Prozent. So ließen die Dehneigenschaften und das Backvolumen nach. In der Teigverarbeitung zeigte sich hingegen, dass sich bei einem höheren Gehalt die Verarbeitungszeit verkürzt.
Die Autoren: Heinz Oberndorfer (Lebensmittel-HTL Wels) und Patrick Falkensteiner (Boden.Wasser.Schutz.Beratung)
- Bildquellen -
- Semmelbackversuche: HTLLMT Wels
- Sorghumhirse: LK OÖ