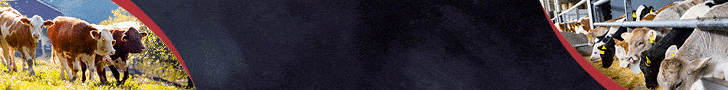Die Möglichkeiten der Genom-Editierung in der Nutztierzucht sind noch nicht systematisch erforscht worden. Der vom Freistaat Bayern durch dessen Forschungsstiftung geförderte Forschungsverbund „FORTiGe“ wollte nun klären, inwiefern mit den molekularbiologischen Methoden der Genomanalyse und der Genom-Editierung die Tiergesundheit verbessert werden kann. Dafür haben die Forscherinnen und Forscher der Technischen Universität München TUM) genomweite Untersuchungen und die Genschere CRISPR-Cas9 eingesetzt. Mithilfe dieses Verfahrens können gezielt DNA-Bausteine im Erbgut umgeschrieben werden. Dabei wurden ausschließlich genetische Veränderungen anvisiert, die so auch in der Natur vorkommen könnten. Solche Veränderungen könnten auch mit klassischer Tierzüchtung erreicht werden, doch das kann viele Generationen und Jahrzehnte dauern. Die Genom-Editierung dagegen führt binnen weniger Generationen zum Ziel.
Tiergesundheit sicherstellen
Beim Rind identifizierten die Wissenschaftler Gene, die den Geburtsverlauf, die Jungtiergesundheit und die Widerstandsfähigkeit des Stoffwechsels von Kühen maßgeblich beeinflussen. „Einige der identifizierten Genomstellen können künftig zur Verbesserung der Tiergesundheit genutzt werden“, erklärte Ruedi Fries, Professor für Tierzucht an der TUM und Sprecher des Verbunds. Eine Arbeitsgruppe um Professorin Angelika Schnieke fand eine Möglichkeit, per Genom-Editierung Schweine zu erzeugen, die gegen die Ödemkrankheit resistent sind. Diese Infektionskrankheit betrifft vor allem frisch abgesetzte Ferkel, deren Darmmilieu durch die Futterumstellung aus dem Gleichgewicht geraten ist. Bei anfälligen Tieren können sich pathogene „Escherichia Coli“-Keime stark vermehren und durch Toxine zum Tod der Ferkel führen. Bislang werden gegen diese Kolibakterien häufig Antibiotika eingesetzt.
Leukämie bei Geflügel vermeiden
Darüber hinaus konnten von einer Forschergruppe um Professor Benjamin Schusser genomeditierte Hühner gezüchtet werden, die gegen das aviäre Leukosevirus resistent sind. Die Resistenz wurde durch immunologische Untersuchungen und Infektionsversuche sowohl in Zellkulturen als auch bei lebenden Tieren bestätigt. Schusser: „Die Vogel-Leukämie kann bei Geflügel zu schweren Erkrankungen und starker Wachstums- sowie Legedepression führen. Durch unsere Forschungen könnten nun Tierherden aufgebaut werden, die nicht krank werden, weil sie gegen diese Viren resistent sind.“
Perspektiven für die Landwirte
In allen Untersuchungen habe man genetische Veränderungen verwendet, wie sie auch auf natürliche Weise vorkommen könnten, betonte Professor Fries. So findet sich die Genvariante, die zur Resistenz gegen die Ödemkrankheit bei Schweinen führt, zwar in bestimmten Rassen. „Bei den Zuchttieren in Bayern kommt diese aber nur selten vor.“ Auch die Variante eines bestimmten Proteins, die zur Resistenz gegen das aviäre Leukosevirus führt, kommt beim Huhn nicht vor, „es findet sich aber etwa bei Wachteln“. Fries: „Die Forschungsresultate eröffnen uns realistische Perspektiven zur Unterstützung der Landwirte in ihren Bestrebungen, die Tiergesundheit und das Tierwohl in ihren Ställen zu verbessern.“
Kein Verständnis für Massentierhaltung
Das Verbundprojekt nahm auch die gesellschaftlichen und juristischen Fragen in den Blick. In einer sozialwissenschaftlichen Analyse untersuchten Ruth Müller, Professorin im Zentrum für Wissenschafts- und Technologiepolitik der TUM, welche Anwendungsmöglichkeiten die Genom-Editierung beim Tier in einem regionalen, bäuerlichen Kontext haben könnte. Dazu wurden nicht nur Gespräche mit Bauern und Züchtern, auch mit Wissenschaftlern und Bürgern geführt, um die gesellschaftliche Akzeptanz für eine Anwendung der Genom-Editierung in der Tierzucht auszuloten. Laut Müller habe diese Studie gezeigt, dass sowohl für Landwirte als auch für die breite Öffentlichkeit heute nicht mehr Fragen der Sicherheit der Technologie vorrangig seien und ob und wie die Genom-Editierung in der Tierzucht eingesetzt werden könnte. „Vielmehr stehen Überlegungen darüber im Vordergrund, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen soll und welche Rolle neue Technologien zur Stärkung einer lokalen ökologischen und tiergerechteren Landwirtschaft in kleinen und mittelgroßen Betrieben spielen könnten.“ Den Einsatz von Genom-Editierung für die Massentierhaltung in großem Stil lehne vor allem die breite Bevölkerung ab.
Die rechtswissenschaftliche Begleitforschung stand im Zeichen des EuGH-Urteils vom 25. Juli 2018, wonach genomeditierte Organismen grundsätzlich als „genetisch veränderte Organismen“ (GVO) einzustufen sind. Daher sei eine Umsetzung der erwähnten naturwissenschaftlichen Forschungsresultate in die landwirtschaftliche Praxis mit der aktuellen GVO-Gesetzgebung kaum realistisch. Rechtsprofessor Hans-Georg Dederer von der Universität Passau schlägt daher folgende Änderungen der einschlägigen EU-Richtlinien vor: „Genomeditierte Tiere sollten vom Anwendungsbereich des Gentechnikrechts ausgenommen werden, soweit mittels Genom-Editierung nur solche genetischen Veränderungen bewirkt werden, wie sie sich auch auf natürliche Weise oder im Wege klassischer Tierzüchtung ergeben.