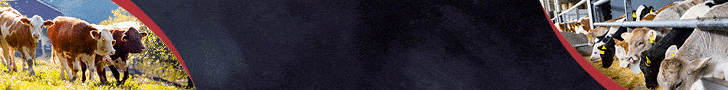Eine an die natürlichen Gegebenheiten angepasste Bewirtschaftung des Grünlands trägt bei zu Artenvielfalt und Bodengesundheit, diesen Leitsatz formulierte der Umweltökologe der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Dr. Andreas Bohner, im Rahmen einer Pressereise der Arge Heumilch durch die Region Bregenzerwald. Zu den “angepassten bzw. eher extensiven Bewirtschaftungsformen” zählte Bohner auch die Heuwerbung wie sie im Rahmen der Arge Heumilch praktiziert wird. Bohner: „Böden sind Lebensräume für Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen. Sie erzeugen Nahrungs- und Futtermittel, sorgen für sauberes Trinkwasser, schützen vor Überschwemmung, speichern Kohlenstoff, Wasser und Pflanzennährelemente und sie liefern Energie und Rohstoffe.“ Böden seien in weiten Teilen Österreichs 15.000 Jahre alt und zählten damit zu den nicht erneuerbaren Ressourcen.
 Quelle: Arge Heumilch
Quelle: Arge HeumilchAngepasste Bewirtschaftung
Bei einer Besichtigung der Vorsäß Ahornen an den Hängen der Kanisfluh bei Mellau erläuterte Bohner einige Leitlinien der Bewirtschaftung unter dem Blickwinkel der Bodenfruchtbarkeit und positiver Klimawirkungen im Dauergrünland. Sie lauten:
- Kenne Deinen Standort!
- Passe die Bewirtschaftungsmaßnahmen an!
- Achte bei Drainagierungen darauf, dass nicht zuviel Wasser abgeleitet wird!
- Gib bei der Schnitthöhe etwas dazu!
- Vermeide Bodenverdichtungen!
Zunächst gelte es, so der Wissenschaftler, den Bodentyp des eigenen Grünlandstandortes zu kennen. Ob es sich mehr um silikatische oder kalkgeprägte Standorte handle, sei ausschlaggebend für weitere Düngemaßnahmen, insbesondere für häufig notwendige Kalkgaben. Neben Bodenproben sind auch Zeigerpflanzen hilfreich, um den Bodentyp einzuordnen.
Je nach der Ertragsfähigkeit sollte in der Folge für jede Fläche die Bewirtschaftungsintensität festgelegt werden. (Anmerkung: Dazu liegt das in den 1980er-Jahren von Walter Dietl in der Schweiz entwickelte Konzept des “Abgestuften Wiesenbaus” vor, das in jüngerer Vergangenheit unter dem Eindruck der Klimaerwärmung als “Abgestufte Grünlandwirtschaft” auch in Österreich neue Aktualität erhalten hat und durch die Fachberatung propagiert wird.)
Schnitthäufigkeit je nach Ertragskraft
Bei der Bewirtschaftungsintensität empfiehlt Bohner, die Schnitthäufigkeit nach dem Ertragsvermögen auszurichten. Geeignete Standorte vertragen vier bis fünf Schnitte, während es anderswo nur zwei bis drei sind – wobei diese Unterschiede auch innerhalb ein und desselben Betriebes auftreten können.
Drainagen zustoppeln
Unter dem Eindruck zunehmend höherer Temperaturen und steigender Verdunstung empfahl Bohner auch, den Wasserhaushalt jedes Standortes zu überprüfen. Häufig seien nasse Wiesen zu Trockenstandorten geworden, die immer noch drainagiert würden. “Drainagen zustoppeln!” lautet hier Bohners oft mit Widerspruch aufgenommener Zuruf.
Sechs bis acht Zentimeter Schnitthöhe
Was die Schnitthöhe betrifft, so ortet der Fachmann immer noch zu tiefe Arbeitsweise. Bei sechs bis acht statt vier bis fünf Zentimetern gewinnen Landwirt, Vieh und Natur, so Bohner. Höherer Schnitt bringe über das Jahr gesehen mehr Futter, das von besserer Qualität sei, weil weniger verschmutzt und auch Maschinen und Geräte würden länger halten.
Schwere Maschinen als Hauptproblem
Zu den Hauptproblemen bei Grünlandböden zählt Bohner übermäßige Verdichtung. Schwere Maschinen bei ungünstigen Bodenverhältnissen führen zu Verdichtungen. Dabei nehmen die Grobporen ab und es kommt ein nachteiliger Prozess in Gang – Niederschläge fließen ab, das Bodenleben leidet, die Ertragskraft schwindet, ungünstige Pflanzen breiten sich aus.
Standortangepasste Bewirtschaftung verbessert den Humusgehalt
Einen besonders wichtigen Beitrag für gesunde Böden leisten die Heumilchbäuerinnen und -bauern, die das Grünland als Weide- und Mahdflächen nutzen. „Durch die schonende und standortangepasste Bewirtschaftung steigt der Humus-Gehalt im Boden ganz natürlich – je nach Standort auf bis zu acht Prozent“, fasste Bohner zusammen.
Seitens der Arge Heumilch ergänzte Obmann Karl Neuhofer: „Mit ihrer nachhaltigen Bewirtschaftung tragen die Heumilchbauern zum Klimaschutz bei, indem sie das Dauergrünland im Jahreskreislauf pflegen und erhalten. Die Wiesen und Weiden werden mosaikartig bewirtschaftet und somit die Artenvielfalt geschützt, die wertvollen Böden gewissenhaft genutzt und bleiben dadurch als Kohlenstoffspeicher erhalten. So wird das wertvolle Dauergrünland für die Heumilchkühe und für kommende Generationen bewahrt.“
- Bildquellen -
- 230701 W Heumilch Moesl Bohner Neuhofer: Arge Heumilch
- 230701 W Heumilchwiese Bregenzerwald: Arge Heumilch