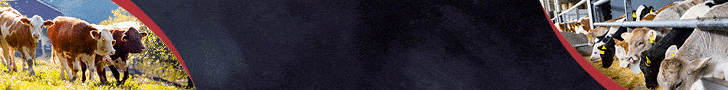Der Wald sei ein Hauptbetroffener der Klimaveränderung, zugleich aber auch ein starker Player zur Lösung des Klimaproblems, betonen die beiden Vorarlberger. „Wenn wir die vielen positiven Wirkungen des Waldes für die Gesundheit der Bevölkerung, für eine gesunde Wirtschaft und für gesundheitsfördernde Lebensräume sicherstellen wollen, müssen wir zunächst einmal schauen, dass der Wald gesund bleibt“, so Landesrat Christian Gantner. Dazu empfiehlt die Waldstrategie 2030+ des Landes die Erhaltung und Schaffung von Mischwäldern, welche am widerstandsfähigsten gegen gehäuft auftretende Risikofaktoren wie Stürme, Trockenheit und verschiedene Schadorganismen sind. Durch nachhaltige Bewirtschaftung könne die Anpassung an geänderte Klimabedingungen besser gesteuert und wesentlich rascher vollzogen werden.
Fast 1.000 Hektar im Jahr neu bewaldet
In Vorarlberg gibt es rund 98.000 Hektar Waldflächen, jährlich werden im Durchschnitt ca. 1.000 Hektar neu bewaldet. „Hier gilt es, die Weichen richtig zu stellen und von vornherein Bäume zu pflanzen, die auch unter zukünftigen Bedingungen gesund wachsen können. Neben den bewährten heimischen Baumarten, die teilweise in höhere Bereiche vordringen werden, sollen punktuell auch Baum-arten aus wärmeren Klimazonen untergemischt werden“, erklärte Landesrat Gantner.
Im Zeichen des Klimawandels ist die nachhaltige Energiegewinnung unverzichtbar. Hier sei der Wald einer der entscheidenden Player. Die Holzbiomasse könne, neben den anderen erneuerbaren Energieträgern, einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten.
Biodiversität wird gefördert
„Mit den in Vorarlberg praktizierten naturnahen Eingriffen in der Waldbewirtschaftung wird die vorhandene Biodiversität gefördert. Auch wird mit einer aktiven Waldbewirtschaftung die Bestandesstabilität und die Altersstruktur im Wald verbessert und die Waldverjüngung in unseren Schutzwäldern gefördert. Mehr als zwei Drittel des zusätzlich möglichen Holzeinschlages können dabei langfristig in die stoffliche Nutzung gehen, beispielsweise in den wohnbiologisch wertvollen Holzbau. Etwa ein Drittel kann im Holzenergiebereich verwendet werden. Zusammen mit der Restholznutzung aus Holzverarbeitung ergeben sich bedeutende zusätzliche Energiepotenziale aus Holzbiomasse von etwa 335.000 Schüttraummeter pro Jahr. Das sind mit etwa 330 Gigawattstunden drei Mal so viel wie derzeit in Vorarlberg mit Photovoltaikanlagen erzeugt wird. Für die Nutzung dieser Potenziale ist es entscheidend, dass die Rentabilität in unseren aufwendigen Gebirgswaldnutzungen gegeben ist. Nur mit einer stärkeren Organisation und Unterstützung unserer ausgeprägten Kleinwaldbesitzerstruktur mit den vielen kleinen Waldparzellen kann dies gelingen“, so LK-Präsident Josef Moosbrugger.
Holzbauland Vorarlberg
Im Holzbauland Vorarlberg bieten sich viele Chancen in der Nutzung und Verarbeitung der natürlichen, nachwachsenden Rohstoffquelle Holz. So schaffen Ernte und Verarbeitung von Holz ca. 3.000 vorwiegend regionale Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Davon gibt es allein in der Vorarlberger Holzbaubranche mittlerweile ca. 1.000. „Die Nutzung des natürlich nachwachsenden Rohstoffes Holz ist zur Erhaltung und Stabilisierung unserer Wälder, zum Schutz von Siedlungen und Verkehrswegen sowie zur Erzielung wichtiger Wertschöpfung in den Regionen unabdingbar. Die Wertschöpfungskette Holz, mit der über die Landesgrenzen hinaus bekannten Vorarlberger Holzbaukunst, ist zukunftsweisend. Die ca. 340.000 Festmeter Holz könnten, ohne die Nachhaltigkeit zu gefährden, langfristig auf ca. 450.000 Festmeter gesteigert werden – es besteht also noch zusätzliches Potenzial für den Vorarlberger Holzbau“, unterstreicht Gantner.
- Bildquellen -
- Gantner und Moosbrugger: Land Vorarlberg/Hofmeister