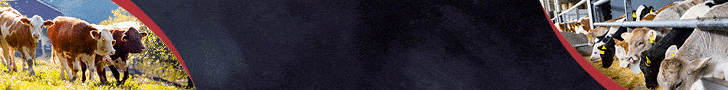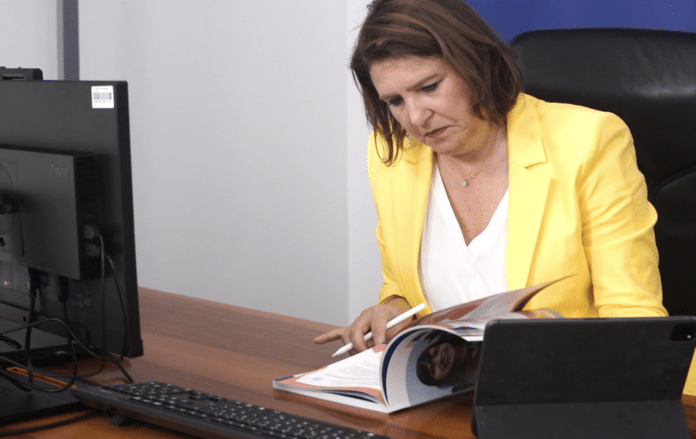Die Wiedereinziehung vorschriftswidriger Ausgaben von Empfängern von EU-Geldern ist ein Schlüsselelement der internen Kontrollsysteme der EU. Laut Helga Berger, Österreichs oberster Vertreterin im EU-Rechnungshof in Luxemburg, hat dieser aber festgestellt, dass die Wiedereinziehung zu Unrecht bezogener Gelder oft zu lange dauere.
Von 2014 bis 2022 wurden über alle Politikbereiche hinweg vorschriftswidrige Ausgaben in Höhe von 14 Milliarden Euro gemeldet. Bei den Agrarfonds, die von den dafür in erster Linie verantwortlichen EU-Mitgliedsländern gemeinsam mit der EU-Kommission verwaltet werden, seien die Eintreibungsquoten allgemein niedrig. Allerdings gebe es laut Berger große Unterschiede zwischen den einzelnen EU-Ländern. Bei der Wiedereinziehung von EU-Geldern wird die Rückzahlung verlangt, wenn sich die Empfänger des Geldes nicht an die mit der EU-Finanzierung verknüpften Anforderungen gehalten haben.
Einmal ausgezahlte Beträge einzutreiben dauert meist nicht nur lange, sondern erweise sich immer wieder auch als unmöglich. Berger: „Unsere Prüfer stellten fest, dass zwischen dem Ende geförderter Maßnahmen und einer Rückforderung oft 14 bis 23 Monate vergehen. Weitere drei bis fünf Monate verstreichen, bevor die Mittel erstattet werden. In bis zu acht Prozent der Fälle wird sogar völlig auf die Forderung verzichtet.“ Dem Jahresbericht des Europäischen Rechnungshofs für 2022 zufolge stieg der Anteil falsch ausgegebener Mittel zwischen 2021 und 2022 von drei auf 4,2 Prozent des Haushalts, was eine effektive Wiedereinziehung umso dringlicher mache. Da aber nur 20 Prozent des EU-Haushalts direkt von der EU-Kommission verwaltet werden, erweise es sich mitunter als schwierig, die Mittel zurückzuholen.
Die Prüfer in Luxemburg kritisieren auch den langen Zeitraum zwischen der Aufdeckung einer vorschriftswidrigen Zahlung und deren Rückforderung als Hauptproblem in den Bereichen der direkten und der indirekten Mittelverwaltung. Bei den außenpolitischen Maßnahmen lägen mitunter auch keine vollständigen Informationen zur Tragweite der vorschriftswidrigen Ausgaben vor.
Damit vorschriftswidrige Ausgaben im Rahmen der EU-Außenpolitik schneller wieder eingetrieben werden können, sollte nach Ansicht der Prüfer nicht nur die Zeit bis zur Feststellung solcher Fehler verkürzt werden, sondern auch die Zeit bis zur Einleitung von Rückforderungsverfahren. Sie empfehlen daher eine verbesserte Planung der Prüfungen und eine Analyse der finanziellen Auswirkungen im Falle systematischer Falschausgaben. Damit die EU-Länder Gelder im Agrarbereich zurückholen, schlagen die Prüfer außerdem vor, bestimmte Anreize wieder einzuführen, die es während des vorherigen Förderzeitraums gegeben hatte. Berger: „Damals galt die Regel, dass die Mitgliedsländer die Hälfte der Mittel, die sie innerhalb von vier bis acht Jahren nicht wieder eingetrieben hatten, an den EU-Haushalt zurückzahlen mussten.“
Auch sollte die EU-Kommission nach Auffassung der Prüfer jedes Jahr genaue Daten dazu vorlegen, welche Ausgaben als vorschriftswidrig ermittelt wurden und welche Korrekturmaßnahmen ergriffen wurden.
Österreich ist musterhaft
In Österreich wurden von 2007 bis 2022 für Direktzahlungen und Marktmaßnahmen rund 66 Millionen Euro aus dem Garantiefonds für die Landwirtschaft vorschriftswidrig ausgezahlt (EU insgesamt: 2,4 Mrd. €). Die Wiedereinziehungsrate liegt bei 92 Prozent. Berger: „Das ist weit über dem EU-Durchschnitt von 52 Prozent und der höchste Anteil innerhalb der EU-27, vor Litauen mit 91 Prozent sowie Finnland und Slowenien mit je 89 Prozent.“ Gleichzeitig sei Österreich unter jenen Mitgliedstaaten, die keine Abschreibungen von Rückforderungen vorgenommen haben. „Die höchsten Abschreibungsquoten verzeichnen die Niederlande mit 48 und Dänemark mit 45 Prozent“, weiß Berger. Das zeige, dass Österreich „ein gut funktionierendes Verwaltungs- und Kontrollsystem eingerichtet hat und seinen Verpflichtungen zum Schutz der finanziellen Interessen der EU umfassend nachkommt“, lobt die penible Verwaltungsjuristin.
Hintergrund
Nicht alle Mittel des EU-Haushalts werden direkt von der EU-Kommission ausgegeben. Rund 70 Prozent werden mit den EU-Ländern verwaltet, 20 Prozent von der Kommission direkt und 10 Prozent indirekt von internationalen Organisationen oder Drittstaaten. Bei der direkten und der indirekten Mittelverwaltung ist die Kommission für die Feststellung vorschriftswidriger Ausgaben und deren Wiedereinziehung zuständig. Im Falle der geteilten Mittelverwaltung überträgt man in Brüssel diese Aufgaben den Mitgliedsländern, trägt jedoch die oberste Verantwortung für die Gewähr. Wenn EU-Mittel nicht nach den einschlägigen Regeln ausgegeben werden, spricht man von vorschriftswidrigen Ausgaben. 2022 machten diese 4,2 Prozent des Haushalts aus.
- Bildquellen -
- Helga Berger: BKA/LEA