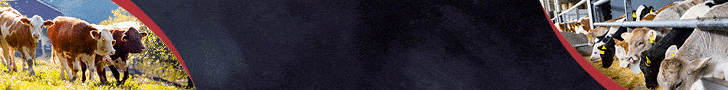Wer kennt ihn nicht, Erich Kästners oft zitierten Neujahrswunsch: „Wird’s besser? Wird’s schlimmer? Fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich!“ Was hier scheinbar so leichtfüßig und mit Augenzwinkern gereimt wurde, ist ein Gedanke, dem wir nicht nur zum Jahreswechsel mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. Oder wie es im Volksmund oft nicht weniger flapsig formuliert wird: Das Leben ist kein Wunschkonzert. Doch nicht nur in der Politik ist man sehr schnell beim sogenannten „Vollkasko-Staat“, bei der Erwartungshaltung, dass uns dieser Staat alle Sorgen und möglichst jede Verantwortung für ein gesichertes Leben abnimmt, koste es, was es wolle. Die Auswüchse und verhaltensoriginellen Vorstellungen dieser Haltung können wir ohnehin täglich medial verfolgen: Forderungen zur Abschaffung der Schulnoten und der Matura sind hier die unseligen Geschwister im Geiste eines fast schon epidemisch um sich greifenden Anspruchs, dass Wohlstand kein zu erarbeitendes Ziel, sondern ein Recht für alle sei; so weit, so bekannt und an dieser Stelle ohnehin bereits mehrmals erörtert. Warum ist das aber so?
Kleines Gedankenspiel
Manches wird dort sichtbar, wo wir es am wenigsten erwarten. Viele Leserinnen und Leser von NEUES LAND erinnern sich bestimmt noch an Zeiten, in denen Weihnachtskekse zumindest bis zum Heiligen Abend ein streng bewachtes, oft auch gut verstecktes Familiengut waren. Mittlerweile ist es in den meisten Familien völlig üblich geworden, dass der Großteil der Weihnachtsbäckerei die Feiertage nicht mehr erlebt, es sei denn, die „Produktion“ wurde vorausschauend merklich erhöht.
Natürlich ist diese Beobachtung für sich selbst gesehen völlig belanglos und nicht allgemeingültig. Letztlich war dies auch nicht mehr als eine Tradition, vielleicht auch vorweihnachtliche Disziplinierung, denn das Christkind bevorzugt ja bekanntlich die Braven. Oder war es vielleicht doch mehr? Traditionen, in diesem Fall, das sich jährlich Wiederholende, stellen uns ebenso wie das Warten-Müssen, in diesem Fall auf das erst künftig Verfügbare, in einen Zeithorizont, in dem uns, um es mit einem bekannten Wort des deutschen Autors und Filmemachers Alexander Kluge zu formulieren, der „Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit“ nicht völlig beherrscht.
Zukunftskompetenz
„Wir wollen alles, und alles auch sofort!“ – „Wenn wir jetzt nicht unverzüglich so handeln, wie manche glauben, dass wir handeln müssen, dann ist alles verloren!“ So, oder so ähnlich ist die Grundstimmung in unserer Gesellschaft geworden.
Noch vor dem Jahreswechsel hat ein Kolumnist der Tageszeitung „Die Presse“ davor gewarnt, uns nur wegen der „Ewiggestrigen“ Sorgen zu machen. Die „Ewigheutigen“ seien zumindest ebenso gefährlich. Wir verharren – sei an dieser Stelle hinzugefügt – zunehmend im „rasenden Stillstand“ (Paul Virilio): Die Politik lässt sich von Umfragen treiben, Ehen scheitern, weil es halt gerade jetzt nicht passt, für aktien-notierte Unternehmen sind die aktuellen Dividenden wichtiger als ein nachhaltiges Managementkonzept. Das gilt nicht immer und überall, aber immer öfter.
Für diese Gegenwartsfixiertheit, man könnte auch von „Augenblicksverliebtheit“ sprechen, gibt es eine Reihe von meist nicht guten Gründen. „Zukunft braucht Herkunft“, ist eine in Sonntagsreden gerne verwendete Formulierung und sie stimmt ja auch. Doch wenn der öffentliche Diskurs ständig die Vergangenheit eindunkelt – Stichwort: Radetzkymarsch – oder die Zukunft nur mehr als Apokalypse – Stichwort: Letzte Generation – zu denken bereit ist, dann bleibt nur ein flüchtiger Zeitgeist, und sei er noch so geistlos.
Was wir heute – wahrscheinlich mehr als je zuvor – benötigen, sind Menschen und wohl auch Institutionen, die uns auf einem tragfähigen Fundament von Werten ein Hoffnung gebendes Bild von Zukunft vermitteln können. „Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr“ heißt es in einem Gedicht von Ingeborg Bachmann. Ohne festen Boden unter den Füßen ist es schwer, im Leben weiterzukommen. Nur wo finden wir diese Menschen und Institutionen?
In den letzten Tagen hat die steirische Öffentlichkeit intensiv die Frage diskutiert, ob sich (zumindest) einer der Heiligen drei Könige überhaupt noch schwarz schminken darf. Für die einen ist dies Rassismus, für die anderen ein Zeichen, dass Menschen aller Hautfarben bei Jesus und in der Kirche willkommen sind. Beide Argumente haben was für sich, keiner Seite sei hier abgesprochen, das Richtige zu wollen. Aber es ist auch nicht wegzudiskutieren, dass sich viele, ob sie nun die ungeschminkten Könige ihre Häuser betreten ließen oder nicht, vor allem daran gestoßen haben, dass sich „nun auch schon“ die Kirche vor lauter Sorge, nicht dem öffentlich diktieren Meinungszeitgeist zu genügen, angepasst habe.
Der im Vorjahr verstorbene große Europäer Karel Schwarzenberg hat einmal gemeint, dass er keine Angst vor vollen Moscheen, sehr wohl aber vor leeren Kirchen hat. Man wird Schwarzenberg kaum gerecht, dies nur als Metapher für seine Sorge angesichts des Verschwindens unserer christlichen Identität und Tradition zu verstehen. Es wäre klüger ihn beim Wort zu nehmen, wenn er von „leeren Kirchen“ spricht.
Freude und Hoffnung
Man muss kein ausgewiesener Statistiker oder Religionswissenschaftler sein, um vorherzusagen, dass in sehr naher Zukunft erstmals in der Republik Österreich weniger als 50 Prozent seiner Bevölkerung Mitglieder der Katholischen Kirche sein werden. Dieser Zeitpunkt wird vor allem große mediale Aufmerksamkeit erzielen und somit hohe Symbolkraft haben; bloß, das ist längst nicht mehr die wichtigste Frage. Natürlich kann man mit dem stets kritisch-loyalen und auch außerhalb der Kirche renommierten Pastoraltheologen Paul Zulehner darauf hinweisen, dass die rund 15 Prozent der Katholikinnen und Katholiken, die noch aktiv in ihren Pfarren beheimatet sind, eine bewusste Entscheidung dafür getroffen haben, während der achtzig- bis neunzigprozentige Kirchgang in den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts nur ein Zeichen von sozialem Druck und Mitläufertum gewesen sei. Und man kann auch einmal mehr das Klagelied der scheinbar naturgesetzlich schrumpfenden „Groß-Institutionen“ anstimmen, und dass es den Menschen halt so bzw. zu gut gehe, und, und, und…
„Gaudium et spes“, auf Deutsch „Freude und Hoffnung“, soll die Kirche den Menschen geben. Das ist der Grundgedanke des pastoralen Abschlussdokuments des II. Vatikanischen Konzils. Dass die Realität diesem Anspruch zu selten genügt, sollte innerhalb UND vor allem außerhalb der Kirche nicht nur mit Achselzucken zur Kenntnis genommen werden. Es müsste und sollte der ureigenste Auftrag der Kirche sein, und hier schließt sich der Kreis dieser Zeitdiagnose, auf einem tragfähigen Fundament von Werten ein Hoffnung gebendes Bild von Zukunft vermitteln zu können.
Und es ist ja nicht so, dass dies den Verantwortlichen innerhalb der Kirche nicht bewusst wäre. Aber warum gelingt hier so wenig?
Über den Kirchturmhorizont hinaus
Pfarrgemeinden, besser wäre es von Pfarrgemeinschaften zu sprechen, sind nach dem Ende der „Volkskirche“ in ständiger Gefahr, zu geschlossenen Gesellschaften zu werden. Ob im großen synodalen Prozess oder im kleinen Pfarrgemeinderat, man beschäftigt sich hauptsächlich mit sich selbst oder versucht – meist verkrampft – Zeitgeistpolitik zu betreiben. Wenn Umfragen zeigen, dass selbst unter den Katholikinnen und Katholiken nur mehr eine Minderheit an Gott glaubt, wird nachvollziehbar, warum beispielsweise CO2-neutrale Kirchenheizungen, die Bekämpfung realer oder vermeintlicher Armut das Frauenpriestertum oder der Zölibat einen so hohen Stellenwert haben. Natürlich sind das alles wichtige Themen, aber zum Kernauftrag der Kirche gehören sie nicht. Niemanden wird man damit „von außerhalb“ interessieren oder gar gewinnen können.
Wir bekennen uns zwar in jeder Messe zur „Heiligen Katholischen Kirche“, doch unser Umgang mit ihr erinnert mehr an das Abholen priesterlicher Dienstleistungen, an die Gemeinschaftskultur örtlicher Vereine oder an die gerne angenommene Behübschung im sonst oft eintönig gewordenen Alltagsleben.
Ruhig wird es dagegen meist, wenn es um die Zusage eines gelingenden Lebens im Vertrauen auf Gott, um die Freude am Glauben, um das Wissen über die Botschaft Jesu geht oder um eine Spiritualität als lebensbejahende Ressource geht. Wer will, dass die Kirche wieder zur Freude und Hoffnung wird, darf sie nicht länger als weltliches Wunschkonzert kleinteilig-organisatorischer und zeitgeistiger Interessen klein halten.
- Bildquellen -
- Zeitdiagnosen Wundschuh Im Nebel: Greiner